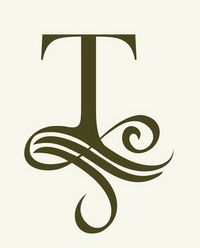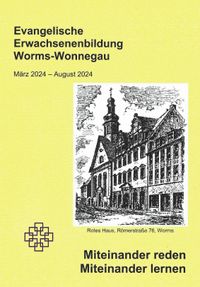T wie Tillich.
Von A bis Z. Wegweisende Texte 17
Tillich
Liebe Leserin, lieber Leser,
heute möchte ich Sie mit einem großen christlichen Denker des 20. Jahrhunderts vertraut machen, weil ich davon überzeugt bin, dass er uns helfen kann, unseren christlichen Glauben in der heutigen Zeit und Welt überzeugend zu leben und gegenüber kritischen Anfragen zu verantworten.
Dabei geschieht dies nicht dadurch, dass unbequeme Fragen und Zweifel ausgeblendet werden. Denn so Tillich: „Der Zweifel wird nicht durch Unterdrückung, sondern durch Mut überwunden. Der Mut verleugnet nicht, dass Zweifel da ist; aber er nimmt den Zweifel als Ausdruck der menschlichen Endlichkeit in sich auf und bejaht trotz des Zweifels das, was unbedingt angeht. Der Mut hat die Sicherheit einer fraglosen Überzeugung nicht nötig. Er schließt das Wagnis ein, ohne das kein schöpferisches Leben möglich ist.“
Wie also sollen wir mit Glaubenszweifeln umgehen? Zunächst ist wichtig, dass wir ernsthaft die Wahrheit zu ergründen suchen und uns nicht einer angeblichen Autorität blind unterwerfen. Weiter gilt es zu sondieren, was fraglos gewiss ist und was in den Bereich des Glaubenswagnisses gehört. Schließlich ist es an uns abzuwägen, ob die christliche Botschaft für mich glaubwürdig, überzeugend und lebensförderlich ist. Ob wir dann das Wagnis des Glaubens eingehen, ist eine Frage des Mutes. Dazu kann uns aber das Lebens- und Glaubenszeugnis vieler Christen und Christinnen vor uns ermutigen – nicht zuletzt auch das von Paul Tillich.
Es grüßt Sie freundlich
Ihr Werner Zager
Zur Wahrheit gehört auch der Zweifel
Vor 125 Jahren wurde der Theologe Paul Tillich geboren. Sein Thema: Theologie in der modernen Welt
Von Christian Feldmann
Tatsächlich war der Deutsche Paul Tillich nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika zur Kultfigur geworden. Er galt als der bedeutendste Theologe der USA und manchen als ihr größter Denker überhaupt.
Der Weltbürger Tillich stammte aus der tiefsten Provinz. Im Dorf Starzeddel in der Niederlausitz wurde er am 20. August 1886 als Sohn des Pastors geboren. Hungrig nach städtischer Kultur und spannenden akademischen Debatten, begann Paul Tillich nach dem Abitur 1904 Philosophie und Theologie zu studieren, in Berlin, Tübingen, Halle. Doch dann brach der Erste Weltkrieg aus, und der bescherte ihm statt der erhofften Professorenkarriere vier Jahre Dienst als Militärpfarrer an der Westfront und den Zusammenbruch seines bisherigen Weltbilds.
Das Ende einer harmonischen Welt
Im Granatenhagel der Schlachtfelder lernte der junge Wissenschaftler die behäbige Bürgerlichkeit verachten, die mit dem Krieg Geschäfte machte – und das preußische Luthertum gleich dazu, das dieser Gesellschaft fromme Rechtfertigungsmuster lieferte. Der Feldprediger Tillich sprach von der Gnade Gottes wie seine Amtsbrüder auch. Aber er begann die Sünde, die diese Gnade brauchte, in gesellschaftlichen Strukturen anzusiedeln. Er entdeckte die Spuren des menschenfreundlichen Gottes im außerchristlichen Humanismus und träumte von einer sozialistischen Neuordnung der Gesellschaft.
Nach Kriegsende begann Tillich in Berlin zu lehren, wechselte als Theologe und Religionsphilosoph nach Marburg und dann an die Technische Hochschule Dresden. 1929 der nächste Sprung nach Frankfurt am Main als Professor für Philosophie und Soziologie, als Nachfolger des berühmten Max Scheler. Hier in Frankfurt trat Tillich der SPD bei, fungierte als Mitherausgeber der „Neuen Blätter für den Sozialismus“ und warnte vor der heraufziehenden braunen Barbarei.
Wenig Wunder, dass Paul Tillich 1933 als einer der ersten deutschen Professoren aus dem Hochschuldienst entlassen wurde. Max Horkheimer musste seine ganze Überredungskunst aufwenden, bis er den hartnäckig Zögernden ein halbes Jahr später bewegen konnte, nach New York ins schützende Exil zu gehen. Tillich sprach kaum Englisch, bekam erst 1937 eine feste Anstellung und gehörte doch bald zu den führenden Köpfen der Emigrantenkreise.
Er lehrte am Union Theological Seminary New York und an der Harvard University, hielt jede Woche über Kurzwelle eine Radioansprache an die deutsche Opposition und protestierte 1938 auf einer Versammlung im New Yorker Madison Square Garden gegen Hitlers Judenverfolgung: Der Gott Abrahams und der Propheten sei auch der Gott von Jesus und Paulus, von Augustin und Luther. Aber er hämmerte seinen amerikanischen Freunden auch immer wieder ein, dass es neben der götzendienerischen Ersatzreligion der Nation und der Rasse noch ein anderes, antifaschistisches Deutschland gebe.
In seinen Rundfunkansprachen benannte Tillich sehr genau die Schuldigen am Krieg, etwa jene Großgrundbesitzer und Unternehmer, „die dem Nationalsozialismus Waffen und Geld geliefert haben, weil sie vor einer sozialen Neuordnung zitterten“. Aber auch die „dünne, ohnmächtige Geistigkeit“ der deutschen Intellektuellen und die Attacken kirchlicher Repräsentanten gegen Weimarer Republik und Arbeiterbewegung.
Das Christentum stammt nicht aus einer anderen Welt
Tillich hielt Vorträge in der ganzen Welt, nach dem Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft auch in Deutschland, lehnte aber mehrfach den Ruf an eine deutsche Universität ab – auch aus der Überzeugung heraus, „dass die Kirche in ihren leitenden Persönlichkeiten kein Interesse an meinem Kommen hatte“. Er blieb lieber in Harvard, wo er mit der höchsten akademischen Würde der USA geehrt wurde, dem Titel eines University Professor, der keinen Lehrstuhl mit präzise umrissenen Verpflichtungen innehat, sondern lehren kann, was und wann er möchte. 1962 wechselte er schließlich an die Universität Chicago. Er starb am 22. Oktober 1965.
„Die christliche Botschaft darf den Menschen nicht wie ein Fremdkörper aus einer anderen Welt an den Kopf geworfen werden.“ Der Satz könnte über Paul Tillichs gesamter Theologie stehen. Sie suchte den Gottesglauben mit den tatsächlichen Fragen und Sorgen der Menschen zu verbinden, die mit abgegriffenen Wörtern und starren Formeln gespickte Welt der Frömmigkeit an die Alltagserfahrung rückzukoppeln, die Offenbarung in ihrer Bezogenheit auf die Geschichte zu verstehen.
Es gebe keine „Offenbarung überhaupt“, erklärte er in seiner Vorliebe für provokante Formulierungen, die ihm Missverständnisse zuhauf und die Verketzerung als Atheist einbrachte. Es gibt nur die Begegnung zwischen der Offenbarung und meiner konkreten Situation, und ohne eine zuvor gestellte Menschenfrage ist eine Offenbarungsantwort schlicht keine Antwort.
So gesehen ist Religion weder ein System von Lehren über Gott und die Welt noch ein Labyrinth von Riten und Gebräuchen, das nur Insider zu betreten vermögen. „Religion“, erläuterte Tillich, „ist das Ergriffensein von einem letzten Lebenssinn, es ist die Dimension der Tiefe in unserem Leben. Lebendige Religion ist überall da, wo ein Mensch (...) sich ganz hinzugeben imstande ist für etwas, das über ihn hinausgeht.“ Die gläubige Weltsicht müsse sich deshalb in besonderer Weise mit der Wirklichkeit auseinandersetzen. Tillich: „Wenn ich gefragt werde, was der Beweis für den Sündenfall der Welt ist, pflege ich zu antworten: die Religion selber, nämlich eine religiöse Kultur neben einer weltlichen Kultur – ein Tempel neben einem Rathaus, das Abendmahl des Herrn neben einem täglichen Abendessen, das Gebet neben der Arbeit, Meditation neben Forschung, Caritas neben Eros.“
Der Mensch leidet an Sinnlosigkeit, nicht an Sünde
Paul Tillich-stimmte nicht in den beliebten Vorwurf ein, der moderne Mensch, überheblich, bequem, denkfaul und ichbezogen, habe die Antenne für religiöse Werte verloren. Nein, die religiösen Symbole haben vielmehr ihre Verbindlichkeit eingebüßt, weil die Verkünder mit ihnen Missbrauch treiben, sie nicht mehr als über sich selbst hinaus weisende Chiffren einer transzendenten Wirklichkeit verstehen, sondern zu selbstzweckhaften Formeln machen.
Um die Größe des unverfügbaren Gottes zu wahren, müsse Religion stets kritisch sich selbst gegenüber bleiben, den Abstand bewusst machen, der zwischen ihren Symbolen und Gottes transzendenter Wirklichkeit liege. „Um von Gott handeln zu können, muss sich die Religion daher im Namen des Gottes, den sie bejaht, immer selbst verneinen“, stellt Tillich klar und entwickelt eine hochinteressante Symboltheologie: „Gott ist das fundamentale Symbol für das, was uns unbedingt angeht. Hier wäre es wieder falsch, zu fragen: ‚Ist Gott denn nur ein Symbol?‘ Denn die nächste Frage müsste lauten: ‚Ein Symbol wofür?‘ Und dann würde die Antwort heißen: ‚Für Gott.‘ Die Frage nach der Existenz Gottes kann also gar nicht so gestellt werden, sondern es muss heißen: Welches unter den unzähligen Symbolen des Glaubens ist dem Sinn des Glaubens am meisten angemessen?“
Originell klang sein Vorschlag, angesichts der Sinnentleerung des kirchlichen Vokabulars möge die Kirche ein dreißigjähriges Schweigegebot über ihre zentralen Worte verhängen. Für Tillich wird das Mysterium zwar mitten in der Alltagserfahrung offenbar. Aber die Begegnung mit Gott durchbricht diese Erfahrung, erschüttert die bisher geltenden Sicherheiten, macht das bequeme Einrichten im Selbstverständlichen unmöglich, provoziert, bedroht, verändert.
Der moderne Mensch leidet laut Tillich nicht unter der Sünde, sondern unter der Sinnlosigkeit seines Daseins; nicht der Zorn Gottes schreckt ihn, sondern seine Abwesenheit; er fragt nicht nach dem gnädigen Gott wie einst Luther, sondern nach dem wirklichen Gott. Der Mensch Jesus hat diese entfremdete Existenz des Menschen voll und ganz geteilt – und sich dennoch nicht von Gott trennen lassen. Deshalb ist für den, der an Christus glaubt und sich in seine Gottesbeziehung hineinnehmen lässt, die Entfremdung überwunden.
Er erfährt sich in seinem Herumsuchen nach Orientierung, in allen Niederlagen und bei allem Versagen vorbehaltlos bejaht – selbst wenn er radikal an Gott zweifelt und an jeder Möglichkeit eines sinnvollen Lebens.
„Man steht nämlich auch im Zweifeln in der Wahrheit“, sagt Tillich. „Verzweifelt man am Sinn des Lebens, dann ist gerade der Ernst dieses Zweifelns der Ausdruck des Sinnes, in dem man immer noch lebt, der Ausdruck der Gegenwart des Göttlichen im Erlebnis des völligen von ihm Getrenntseins“. Anders gesagt: Begreift der verzweifelte Mensch, dass der Lebenssinn, um den er ringt, nicht das Ziel, sondern schon die Voraussetzung seines Zweifels ist, dann kann ein unwahrscheinlich kraftvoller Glaube wachsen.
Aus: Evangelische Sonntags-Zeitung vom 14.8.2011, S. 11.
Hier finden Sie den Text als PDF zum Downloaden und Ausdrucken.