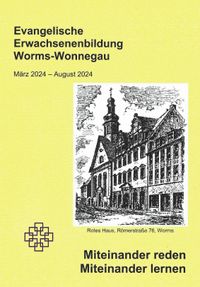B wie Bibel
Von A bis Z. Wegweisende Texte 3
Liebe Leserin, lieber Leser,
Johann Hinrich Claussen, seit 2016 Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (davor Hauptpastor in Hamburg), spricht sich in seinem Beitrag mit überzeugenden Argumenten für ein historisch-kritisches Verständnis der biblischen Texte aus. Damit befindet er sich im Einklang mit Albert Schweitzer, für den es zum Wesen des Protestantismus gehört, die Anfänge der Religion überhaupt und speziell des Christentums ohne falsche Rücksichten zu erforschen, um damit zum bleibenden Gehalt der (christlichen) Religion vorzudringen.
Biblische Texte mit wachem Geist und ohne dogmatische Vorgaben aus ihrem Entstehungszusammenhang zu begreifen, dabei handelt es sich um ein Gebot der intellektuellen Redlichkeit. Bereits Martin Luther hat sich auf dem Reichstag zu Worms nicht nur auf die Bibel berufen, sondern auch auf die Vernunft. Ein fundamentalistisches Bibelverständnis kann sich also nicht auf Luther als Gewährsmann stützen. Und so verwundert es nicht, dass der Reformator schon manche Einsichten vorwegnahm, die erst die historisch-kritische Bibelwissenschaft im 19. Jahrhundert erarbeitet hat.
Für „geisterfüllte Leseerlebnisse“ (um mit Johann Hinrich Claussen zu sprechen) ist es sicher hilfreich, wenn man eine Bibel mit historischen Einführungen benutzt – wie etwa die Stuttgarter Erklärungsbibel, die neben dem Text der Lutherbibel die wichtigsten Erklärungen der exegetischen Forschung enthält. Nicht ohne Grund hatte bereits Luther seine Bibelübersetzung mit Vorreden zu den einzelnen biblischen Schriften versehen.
Es grüßt Sie freundlich
Ihr Werner Zager
Ein Stachel im Fleische
Plädoyer für ein aufgeklärtes Christentum und für die historisch-kritische Erforschung der Bibel
Von Johann Hinrich Claussen
Auch wenn man sich längst an die historisch-kritische Erforschung der Bibel gewöhnt haben mag, sie hat immer noch etwas Schockierendes an sich. Sie bleibt ein Stachel im Fleisch. Was aufgeklärte evangelische Theologen des 18. und 19. Jahrhunderts begannen, ist religionsgeschichtlich einzigartig. Nirgendwo sonst haben berufene Ausleger das heilige Buch ihrer Religion einer so radikalen Wahrheitsprüfung unterzogen. Muslimische oder jüdische Schriftgelehrte wären zu Vergleichbarem weder fähig noch bereit, ebenso wenig wie die Theologen der meisten anderen christlichen Konfessionen.
„Historisch-kritische Methode“ – das klingt nach nüchterner Universitätstheologie und bezeichnet doch eine Revolution. Denn sie ist „ein Sauerteig, der alles verwandelt und der schließlich die ganze bisherige Form theologischer Methoden zersprengt“ (Ernst Troeltsch). Die biblische Metapher beschreibt eine Umkehrung der bisherigen Begründungsverhältnisse: Nicht mehr die Schriftgemäßheit garantiert die Wahrheit einer Glaubensaussage. Eine Lehre wird nicht mehr deshalb als christlich angesehen, „weil sie in der Schrift enthalten ist, da sie doch vielmehr in der Schrift enthalten ist, weil sie zum Christentum gehört“ (Friedrich Schleiermacher). Als theologisches Kriterium ersetzt jetzt die historisch-systematische Bestimmung des „Wesens des Christentums“ die alte Lehre von der Heiligen Schrift.
Auch an der historisch-kritischen Methode ist der deutsche Protestantismus in zwei Teile zerbrochen. Troeltsch hat sie als Alt- und Neuprotestantismus bezeichnet. Damit hat er die epochale Bedeutung dieser Spaltung auf den Begriff gebracht, allerdings den Eindruck erweckt, es handle sich hier um ein zeitliches Nacheinander. Doch der „Altprotestantismus“ ist keine nur vormoderne Größe. Es gibt ihn immer noch und er besitzt seine eigene Modernität. Es wäre darum besser, von „dogmatischem“ und „aufgeklärtem“ Protestantismus zu sprechen. Der dogmatische Protestantismus hat entschiedenen Widerstand gegen die Bibelkritik geleistet und damit in Kirche und Theologie die Meinungsführerschaft behauptet. Der aufgeklärte Protestantismus ist stets eine Minderheitenposition geblieben.
In der Tat, der dogmatische Standpunkt hat einiges für sich. Er stellt gewichtige Fragen: Führt die kritische Bibelexegese nicht zu rein negativen Ergebnissen? Zerstört sie nicht das Fundament für die Gewissheit und damit für den Glauben? Öffnet sie dem Subjektivismus des Auslegers nicht Tor und Tür? Und kann es ihr je gelingen, inhaltliche Übereinstimmung und kirchliche Gemeinschaft herzustellen?
Damit sind zentrale Probleme liberaler Theologie genannt. Dennoch bleibt die historisch-kritische Methode ein schlichtes Gebot intellektueller Redlichkeit. Auch müssen sich die Vertreter des dogmatischen Protestantismus fragen lassen, ob sie die Bibel nicht funktionalisieren. Tut man der Bibel nicht Gewalt an, wenn man sie zum papierenen Papst kürt? Wer ihre absolute Geltung behauptet, tut der dies nicht zu dem Zweck, um eigene Autoritätsansprüche durchzusetzen? Zudem ist die dogmatische Methode kein Schutz vor Beliebigkeit und Subjektivismus. Auch sie unterliegt der Notwendigkeit zur Deutung. Sie muss die Mitte und das Wesen aus der Fülle der biblischen Schriften herausarbeiten. Und das geht nur unter Einsatz der eigenen theologischen Existenz. Ein gutes Beispiel ist Karl Barth, der moderne Kirchenvater der dogmatischen Methode. So sehr er sich auch als biblischer Theologe stilisierte, man erkennt schnell, wie wenig seine Konstruktionen unmittelbar aus der Schrift schöpften, sondern sich individuellen, spezifisch modernen Motiven verdankten. Man lese nur seine spekulative Christologie.
Die dogmatische Methode ist steril
Der gravierendste Mangel der dogmatischen Methode aber ist ihre Sterilität. Es erscheint paradox und ist doch eine häufige Erfahrung, dass diejenigen, die am stärksten die Heiligkeit der Schrift beschwören, am wenigsten mit ihr anzufangen wissen. Ihr Biblizismus erschöpft sich in der formalen Behauptung theologischer Absolutheit, aber er eröffnet keinen Zugang zu den Fragen und Einsichten konkreter biblischer Texte. Orthodoxe Bibelapologeten verharren meist im Allgemeinen und bleiben wortreich sprachlos vor dem einzelnen Text, seinen Problemen und Perspektiven stehen. So dekretierte etwa jüngst Ulrich H.-J. Körtner ganz im Tonfall der Fünfzigerjahre des vergangenen Säkulums: „Gute Theologie erkennt man an ihrem Bemühen um ein Leben mit der Bibel“. Wie ein solches Leben sich gestalten könnte, vermochte er aber nicht zu sagen. Sein Plädoyer für die dogmatische Methode beschränkte sich auf die reflexhafte Abwehr theologischer Zeitgenossenschaft und die Beschwörung eines höchst abstrakten Glaubensbegriffes. Körtner vermittelte nicht einmal eine Ahnung davon, wie der dogmatische Zugriff auf konkrete biblische Texte und Themen neues religiöses Leben freisetzen könnte.
Die exegetische Sterilität der dogmatischen Methode ist allerdings nicht nur ein akademisches Problem, sondern betrifft auch die kirchliche Praxis und religiöse Kultur. Bekanntlich herrscht gegenwärtig eine große Bibelvergessenheit. Eine PISA-Studie in Sachen Bibelkunde würde desaströse Ergebnisse zeitigen. Daran dürfte weniger die kritische Bibelforschung schuld sein, denn sie ist auf Gemeindeebene nie oder nur in homöopathischen Dosierungen angekommen. Dort herrscht zwar keine stolz-offensive Bibelgläubigkeit wie in Amerika, wohl aber ein schüchtern-hartnäckiger Gewohnheitsbiblizismus. Und gerade dieser ist eine der Ursachen für das allgemeine Desinteresse an der Bibel, umgibt er die Bibel doch mit einem Geruch des amtlich Dekretierten, mit einer Aura aus Weihrauch und Kirchenmuff, die nicht einmal mehr zum Protest, sondern nur noch zu instinktivem Gähnen reizt. Ein Buch, von dem immer schon gilt, dass es doch Recht hat, kann niemanden mehr überraschen.
Es wäre nicht der schlechteste Vorsatz für das „Jahr der Bibel“, wenn man aufhörte, ängstlich ihre Heiligkeit zu verteidigen. Denn wer dies tut, verpasst das Eigentliche. Er umwickelt die Bibel mit dogmatischen Behauptungen wie mit Bandagen, um sie zu stützen und zu schützen, und bemerkt nicht, dass er sie dabei einschnürt und mumifiziert. Das Eigentliche der Bibel aber liegt nicht in ihrem dogmatischen Wert, sondern in ihrer Funktion für das religiöse Leben. Sich auf diese Funktion zu konzentrieren, müsste ein gemeinsames Anliegen aufgeklärter und dogmatischer Protestanten sein. Denn großartig und bewegend waren nicht die Lehren über die Schrift, sondern die Geschichten ihrer Wirkungen. Die Schrift ist nicht ihrem Wortbestand nach heilig. Der Buchstabe tötet vielmehr Vernunft und Glauben. Die Bibel ist nicht heilig an sich, sondern weil Menschen durch sie Erfahrungen des Heiligen machen. Insofern ist das protestantische Christentum gerade keine Buchreligion, wohl aber eine Religion geisterfüllter Leseerlebnisse.
Ihre Funktion, Glauben zu wecken, kann die Bibel nicht erfüllen, wenn sie als Sammlung theologischer Richtigkeiten daherkommt. Im Gegenteil, es ist ihre Fremdheit, die aufwühlt, anstößt, umtreibt, neue Sinn- und Lebensmöglichkeiten entdecken lässt. Und ein präzises Verständnis dieser Fremdheit kann nur die historisch-kritische Methode erarbeiten. Wer darüber hinaus ein plastisches, religiös anregendes Bild der biblischen Kontrastwelten gewinnen will, der sollte am besten in die Kunst gehen, sich den immer noch einzig wahren Jesusfilm von Pier Paolo Pasolini anschauen, Arvo Pärts Psalmenvertonungen anhören, die Passions- und Auferstehungsgemälde von Volker Stelzmann betrachten, Chester Browns Comic-Adaption des Matthäusevangeliums lesen oder den vielen biblischen Spuren in der Lyrik der Gegenwart nachgehen – diese Liste unfrommer Anstiftungen zum Bibellesen ließe sich ins Unendliche fortschreiben.
Kurz vor seinem Tod schrieb der achtzigjährige Lyriker Karl Krolow ein Gedicht mit dem schlichten Titel „Worte“ (1995). Darin zog er so etwas wie ein literarisches Resümee. Was steht am Ende eines langen Dichterlebens? Zunächst die bittere Einsicht, dass Worte gerade dadurch miss- und verbraucht werden, dass man sie für heilig erklärt. Dann aber ein überwältigtes Staunen darüber, wie sie neue Lebensmacht gewinnen, wenn man ihnen die Aura des Unangreifbaren nimmt. Krolows lyrisches Testament ließe sich auch als Motto für ein „Jahr der Bibel“ lesen: „Die Worte werden beliebig, wenn man sie oft genug spricht, und einige erst ergiebig, wenn man sie schließlich bricht, wenn man genug geheuchelt, sie seien das A und das O. Hat man sie endlich gemeuchelt, braucht man sie nirgendwo. Glaubt man sie lange vergessen, tauchen sie wieder auf, wird man an ihnen gemessen im sterblichen Lebenslauf.“
Aus: Zeitzeichen Nr. 1/2003, S. 30-32.
Hier finden Sie den Text als PDF zum Downloaden und Ausdrucken.